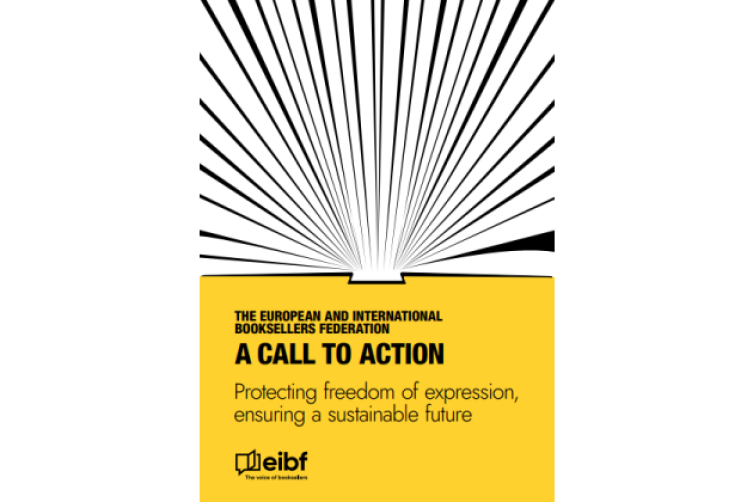Die Rabatte im Print-Geschäft liegen ja längst im Qualbezirk. Zu den Üblichkeiten des Nachlasshandels gehört es, dass die Gespräche hinter verschlossenen Türen geführt werden. Seit ein paar Tagen gibt es aber eine neue Lage: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete über massiven Druck, den Amazon auf die Bonnier-Verlage ausübe. Man fordere 40 bis 50 Prozent Nachlass auf den Verkaufspreis von E-Books; zuletzt sei ein Rabatt von 30 Prozent eingeräumt worden. Um den Verlagskonzern, der den steilen Forderungen widersteht, zum Einlenken zu bewegen, ist der Onlinehändler der Zeitung zufolge dazu übergegangen, viele physische Titel aus den Backlists der Bonnier-Verlage nur noch mit langen Lieferzeiten anzubieten.
Das ist eine Erpressung mit viel Risiko für den Erpresser. Der Form nach lautet die kuriose Drohung: Wenn du nicht machst, was ich sage, werde ich zu deinem Nachteil meine Kunden enttäuschen! Amazons aggressiver Akt gegen diesen Lieferanten trägt also auch autoaggressive Züge. Er spekuliert auf den Angstreflex: Verlage fürchten die Absatzverluste, die eine Herabstufung in der Priorität oder gar eine Auslistung mit sich bringen würde. Im konkreten Fall kam aber betriebswirtschaftliche Vernunft gewissermaßen störend ins Spiel. Bonnier sah die rote Rabattlinie überschritten und gab zur Verblüffung Amazons dem Angstreflex nicht nach.
Die Schlacht hinter dem Scharmützel ist noch mal eine andere. Sie wird um die Autoren geführt. Amazon stößt im physischen Buchhandel an seine Wachstumsgrenze. Jetzt will man versuchen, im Geschäft mit E-Books wie auch in der vertikalen Konzentration zuzulegen. Die Rabattattacke gegen Bonnier dient beiden Zielen. Ein Gewinn an Marge bliebe − ironischerweise dank Preisbindung! − komplett beim Händler. Und das Kalkül in Richtung Autoren ist ein perfide doppeltes: Falls Bonnier einknickte, reduzierte sich mit dem höheren Nachlass zugleich der Autorenanteil am verkauften E-Book. Was schlecht wäre für die Autoren. Falls Bonnier standhaft bliebe, litten Autoren wie Verlage unter den künstlich miserablen Lieferzeiten. Was ebenfalls schlecht wäre für die Autoren. Gut hingegen wären beide Varianten für einen, der vorhat, Schriftsteller zu akquirieren.
Aber dieser Schuss geht nach hinten los. Aktuell erfährt Bonnier viel Solidarität seiner Autoren. Der Carlsen-Cartoonist Joscha Sauer zum Beispiel hat seinem Ärger über den Onlinehändler auf Twitter Luft gemacht. Sein Hinweis auf den Erpressungsversuch wurde hundertfach retweetet: ein Schneeballsystem der Entrüstung, das funktioniert, weil so einer wie Sauer Zigtausende Leute auf Facebook, Twitter & Co. erreicht. Hier wirken Follower, die Jünger des 21. Jahrhunderts, als Korrektiv in einem Kampf mit ungleich verteilten Kräften. Autoren wissen, dass Leser wissen, wie sie auch ohne Amazon rasch an ein gewünschtes Buch kommen. Und Autoren ahnen, was mit ihren Honoraren passieren würde, wenn sie ihre Bücher einst einem übermächtigen Verlag namens Amazon anvertrauten ...
Kartellrechtlich wären jetzt ein paar offensive Ideen willkommen. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen seine ohnehin erhebliche Macht im Zukunftsmarkt der E-Books noch auszubauen versucht, indem es einen digitalen Konditionenstreit mit Druck im Printgeschäft flankiert. Zu Recht stellt der Börsenverein die politische Forderung, über sinnvolle Kartellausnahmen für die Buchbranche nachzudenken. Es gibt Vorbilder − siehe etwa die kartellrechtlichen Freistellungen im Presse-Grosso.
Für stationäre Sortimente liegen im Clinch zwischen Amazon und Bonnier nur Chancen: Der Handel vor Ort kann im Beschaffungsservice punkten. Er kann um Sympathien werben − "wir nehmen unsere Kunden nicht in Geiselhaft für Machtspiele". Er kann sich den Verlagen als der verlässlichere Handelspartner empfehlen. Er kann mit E-Readern überzeugen, die anders als der Kindle dem Kunden seine Freiheit lassen. Die Verlage ihrerseits werden überdenken müssen, wie sie − im wohlverstandenen Eigeninteresse − den stationären Buchhandel spürbar als ihren Handelspartner Nr. 1 behandeln. Amazon zockt. Schon möglich, dass die Firma sich soeben mal verzockt hat.