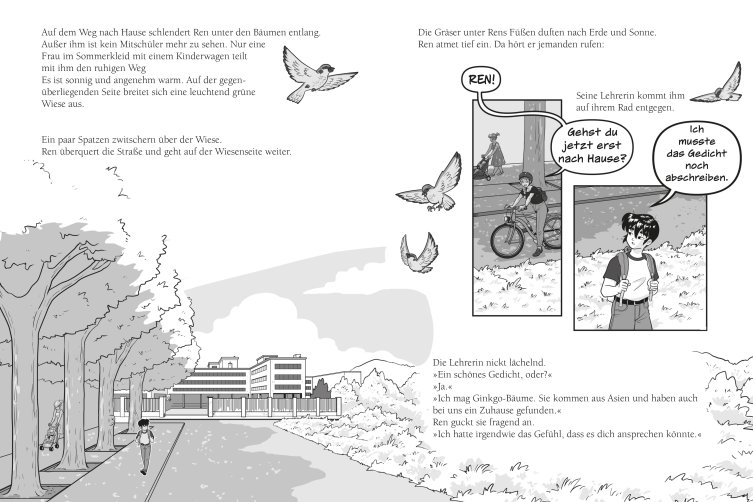Herr Krüger, Sie sollen Ihr Büro zum 31. Dezember an Ihren Nachfolger übergeben. Sieht aber nicht so aus, als wäre der Raum je dazu bereit.
Das Schlimmste sind diese Bücher. Wenn ich eins in die Kiste schmeiße, wo drauf steht »Weg damit!«, dann schaut mich das Buch an und sagt: »Hör mal, ich habe dir doch vor 30 Jahren ein paar ganz tolle Stunden unter einem Lindenbaum gegeben – und jetzt willst du mich wegschmeißen?« Dann sage ich: »Nein, nein, das war ein Versehen«, hole das Buch wieder raus und tue es in die Kiste »Aufheben«. Ich finde in den Büchern Briefe, die plötzlich rausfallen. Gestern habe ich eine Postkarte gefunden in einem Buch von Hildesheimer, wo er mir 1982 mitgeteilt hat, dass er nun nicht mehr schreiben werde.
Sie haben bei Hanser ein Verfahren des Verlegerwechsels verabredet, das nicht einen Übergang vorsieht, sondern vielmehr einen Schnitt. Hätten Sie es sich anders gewünscht?
Der Aufsichtsrat wollte es so. Es war nicht mein Wunsch. Aber nun sei es so. Ich werde über Weihnachten hier sitzen und reinemachen. Und am 31. Dezember werden alle Bücher, Bilder, Papiere, die nicht hierhergehören, den Verlag in irgendeiner Weise verlassen haben. Nun sitzen ja hier Mitarbeiter, nicht zuletzt Frau Feilhauer, die lange die Geschichte des Verlages mitbestimmt haben. Die wissen natürlich, was ich gerne noch gemacht hätte; und die werden die Dinge mit Herrn Lendle, meinem Nachfolger, erörtern.
Im Abschiednehmen wird man sensibel für die Motive kollegialer Anerkennung: War bloß mein Amt gemeint? Oder ich und meine Arbeit? Kennen Sie solche Fragen?
Natürlich. Ich gehöre ja zu denen, die diese Arbeit mit Leib und Seele gemacht haben. Ich war 45 Jahre in ein und demselben Haus. Ich habe andere Angebote immer ausgeschlagen. Denn ich habe mir gedacht: Wenn man einmal sich mit bestimmten Autoren verbündet, deren Werke man betreut, dann sollte man das so lange wie möglich tun. Dann sollte man das nicht leichtsinnig unterbrechen. Das war mein Leben. Durch Zufall bin ich jetzt 70, und dadurch ergibt sich eben ein Bruch. Das ist normal.
Wo wollen Sie in Zukunft leben?
Zunächst mal bin ich ja hier Präsident der Akademie geworden und werde also die nächsten drei Jahre auf jeden Fall hier bleiben. Das ist eine interessante Akademie. Die hat zwar Probleme und kein Geld. Aber sie ist einer der wenigen Orte, wo alle Künste, für die ich mich interessiere – nämlich die bildenden und die darstellenden Künste, der Film, die Musik, die Literatur und die Architektur –, jeweils mit Klassen vertreten werden.
Was interessiert Sie am Miteinander der Künste?
Als ich nach München kam, haben wir hier im Verlag – zum ersten Mal in der Nachkriegszeit – eine Filmbibliothek aufgebaut. Daher kenne ich die Leute alle noch. Und sie sind uns ja zum Teil als Autoren treu geblieben, wie Volker Schlöndorff oder Werner Herzog. Ich habe mich immer für die Malerei interessiert, für die moderne Musik. Wir haben wichtige Musikbücher hier gemacht, gerade für die Moderne, von Wolfgang Rihm bis zu Dieter Schnebel; wir haben Ligeti und auch die Klassik gemacht; bis hin zu Brendel. Auch das Theater hat mich immer für sich eingenommen. Also will ich an der Akademie jetzt versuchen, wieder so einen Ort herzustellen, an dem die Künste miteinander in ein Gespräch kommen. Und zwar über die Frage: Warum brauchen wir das alles?
Wie war das damals, als Sie in München ankamen?
Ich wohnte in Schwabing. In jedem Haus saß ein Schauspieler, ein Regisseur, ein Cutter, ein Kameramann. Man hatte kein Geld, man hat sich gegenseitig geholfen. Ich habe selber in Filmen mitgespielt und habe auch Drehbücher geschrieben. Wir hatten die fantastische Zeitschrift »Filmkritik« von Enno Patalas und Frieda Grafe. Was damals hier mit dem Film los war, das gab’s gar nicht in Berlin. Wir waren die Stadt des Films.
Für Sie ist das Jahr 2013 angefüllt mit öffentlichem Nachdenken über das Abschiednehmen. Dabei fällt auf, dass eine Menge Leute merkwürdig ablehnend, zuweilen sogar aggressiv auf ihre Melancholie reagiert. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das ist seltsam. Denn die Melancholie gehört doch sowieso zur Literatur. Es gibt aber eine jüngere Generation, auch in den Verlagen, die das gar nicht zulassen will. Die sind alle so auf Effektivität hin getrimmt, die müssen alles gut finden. Die erlauben sich nicht, auch nicht für eine Sekunde, irgendeine melancholische Anwandlung darüber, dass möglicherweise eine Zeitenwende passiert. Die wollen auf Gedeih und Verderb positiv denken und folgen dem Programm der Selbstmaximierung: Wie kann ich mich trainieren? Wie kann ich fitter werden für die Gesellschaft? Darüber erscheinen jedes Jahr hundert Bücher. Aber das Nachdenktraining läuft schwer hinterher.
Andererseits sind Menschen zunehmend bereit, darüber nachzudenken, ob und wie sie zwischendurch mal heraustreten können aus den Zwängen ihrer täglichen Arbeit.
Ja, das ist sehr notwendig. Zu meinen schönsten Auszeiten gehören vier Winter in der Villa Massimo. Weil ich nicht ein ganzes Jahr hier weg sein konnte, bin ich immer von Dezember bis März in die Villa gefahren und habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Stadt wirklich zu Fuß erkundet. Vormittags habe ich gearbeitet, später bin ich dann runter ins Zentrum und habe jeden Abend einen dieser fabelhaften Schriftsteller besucht, die damals alle noch lebten – Calvino, Elsa Morante, Manganelli, Agamben. Das war wunderbar. Das war die schönste Zeit. Und sie war so schön, weil ich dann im März immer zurückgefahren bin und sagen konnte: In neun Monaten bin ich wieder da, macht schon mal das Wasser heiß für die Spaghetti.
Nun rücken für Sie ja solche Möglichkeiten wieder näher. Welche Pläne haben Sie?
Zunächst einmal freue ich mich darauf, überhaupt wieder Wochenenden zu haben. Die Sonntage habe ich in der Regel hier im Verlag verbracht. Die Vorstellung, jetzt die Wochenenden zu haben, um mal in die Berge zu fahren oder auch nur unter einem Apfelbaum zu liegen, ist natürlich beglückend. Denn da fällt einem ja auch wieder was ein.
Hört sich so an, als hätte Hanser Sie verschluckt, mit Haut und Haaren.
Dieser Verlag, der sich – nicht zuletzt durch meine Schuld – so vergrößert hat, ist eine Krake geworden. Wenn man das ernst nimmt und sich tatsächlich um jedes Buch kümmert, das bei uns erscheint, dann bleibt für anderes keine Zeit mehr übrig. Die Stadt kenne ich nur am Abend. Ich kaufe ja auch nicht ein.
Man versorgt Sie hier im Büro?
Nein, aber ich gehe ungern Hosen kaufen und so was. Meistens habe ich meine Hosen und Hemden gekauft, wenn ich einmal im Jahr in New York war. Immer im Zehnerpack, sodass ich ein ganzes Jahr über kein deutsches Bekleidungshaus mehr aufsuchen musste. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, in München zum Friseur in die Stadt zu gehen. Das erledige ich, wenn ich unterwegs bin, irgendwo zwischendurch.
Hier draußen gibt es keinen Friseur?
Hier gibt’s überhaupt gar nichts, außer den Salon Hedy. Die mich auch kennt. Die macht mir gelegentlich den Schnellschnitt – acht Minuten ist unsere Meisterleistung.
Haben Sie dem Vorsteher des Börsenvereins schon Ihren Vorschlag unterbreitet, doch endlich einen Preis für Poesie auszuloben?
An dem Brief arbeite ich tatsächlich gerade. Ich glaube, dass unsere Dichter – Lutz Seiler, Jan Wagner, Nora Bossong, Monika Rinck und wie sie alle heißen – wunderbare Schriftsteller sind. Aber selbst, wenn sie Preise für ihre Gedichte kriegen, werden die Auflagen nie höher als 3 000. Meistens bleibt es bei 700, 800 Exemplaren. Deshalb muss es einen großen Preis für Poesie geben. Wir leben jetzt im Zeitalter der Prosa, des zielgerichteten Schreibens. Da sind diese schweifenden, träumerischen, nachdenklichen Typen nicht mehr so gefragt. Deshalb wäre es toll, wenn der Börsenverein so einen Preis erfände – wo dann auch mal für ein, zwei Wochen der Buchhandel mitmacht. Dann hätten wir Fenster voller Poesie.