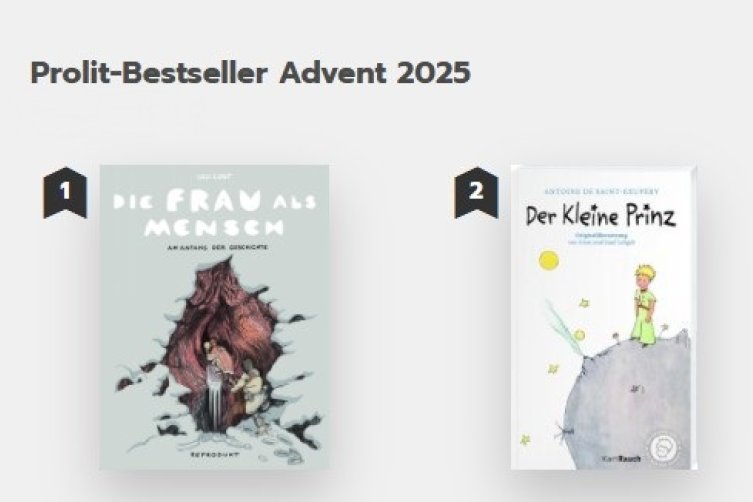In Ihrem neuen Roman »Apostoloff« schicken Sie Ihre Figuren zwei sehr unterschiedliche Schwestern auf eine Reise durch Bulgarien und damit auch auf eine Reise ins Herkunftsland des verstorbenen Vaters. Was geschieht mit diesem ungleichen Geschwisterpaar in der Fremde?
Die Schwester, die die Geschichte erzählt, wird vom toten Vater heimgesucht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Vater spricht, wandert durch die Mauer des Zimmers, erscheint am Horizont, liegt schlafend über dem Schwarzen Meer. Von der anderen Schwester nimmt der Vater in Gestalt eines Stellvertreters auf etwas habhaftere Weise Besitz: sie verliebt sich in den Reiseführer Rumen Apostoloff, der entfernte Ähnlichkeit mit dem toten Vater besitzt.
Bulgarien ist auch die Heimat Ihres Vaters gewesen. War die Arbeit an dem Buch eine Art Spurensuche in der eigenen Geschichte?
Das war es. Es verschränkten sich fiktive und biographische Anteile. Eine größere Rolle spielt in dem Buch der Stuttgarter Emigrantenverein, wie er in meiner Erinnerung fortlebt. Lauter Bulgaren waren das, fast ausschließlich Männer, deren soziale Herkünfte und Berufe sehr verschieden waren, die aber eines gemeinsam hatten: sie heirateten alle schwäbische Blondinen.
Wie haben Sie sich dieser Erzählung genähert? Wie haben Sie recherchiert?
Zweimal bin ich mit meinem Vetter, der fließend Deutsch spricht, durch Bulgarien gereist. Ich war auf den Vetter angewiesen, da ich selbst kein Bulgarisch spreche. Ich kannte das Land nur aus Reisen während der Kinderzeit. Es hat sich inzwischen natürlich sehr verändert. Offen gestanden habe ich noch nie ein so verkommenes Land bereist. Und ich bin einiges gewöhnt, da ich etliche Jahre in Südamerika verbracht habe und früher häufig nach Ägypten gefahren bin. Depressiv, mafiotisch, grob, hässlich. Es mag meine Sichtweise beeinflussen, dass es das Land meines Vaters ist. Sonst würde ich vielleicht gnädiger darüber hinwegsehen. Aber die architektonischen Greuel sind einzigartig. Alles, was nach 1920, spätestens 1940, gebaut wurde, ist von so fataler Hässlichkeit, dass man wirklich erschrickt, wenn man nicht allzu abgebrüht darüber hinwegsieht. Fast alle Städte und Dörfer von Plattenbauten eingekesselt und zerstört. Es ist unbeschreiblich. Dabei hatte Bulgarien in den Jahrhunderten zuvor überragende Baumeister, wie man an den erhalten gebliebenen Klöstern und Moscheen sehen kann. Ich hatte große Mühe, den Roman von der Zerstörung nicht allzusehr anstecken zu lassen. Zugunsten der Kunst, die ja auch der Schönheit verpflichtet ist, muss man ja den Kopf oben behalten.
In Ihren Büchern spürt man immer eine große Lust am Spiel mit verschiedensten Genres, Rollenbildern, Schreibhaltungen und auch philosophischen und religiösen Inhalten. Stets standen männliche Figuren im Mittelpunkt des Geschehens. Mit »Apostoloff« scheint eine Distanz aufgehoben zu sein: Kommt man als Autor an der eigenen Familie nicht vorbei? Und wie empfinden Sie das Verhältnis von Authentizität, Autobiographischem und Literatur?
Im Grunde bin ich gegenüber dem Autobiographischen äußerst skeptisch. Es wird maßlos überbewertet. Wir leiden am Zeugenfieber, am Beglaubigungseifer. Eine Geschichte scheint vielen Lesern nur halb so gut, wenn sie erfunden ist. Auch die Recherche steht in unverdient hohem Kurs. (Es sei daran erinnert, dass Franz Kafka für seine Romane und Geschichten nie etwas recherchiert hat.) Aber an seiner Familie, dieser einzigartigen Zwangsgemeinschaft, kommt ein Autor kaum vorbei. Direkt oder camoufliert, von seiner Familie wird er uns erzählen. Ich habe mir zumindest Luft verschafft, indem ich mir eine fiktive Geschichte und fiktive Figuren hinzu ersonnen habe, die Vater, Mutter, Kind in ein anderes Tableau versetzen. Erinnert sei auch daran: es ist schier unmöglich, die eigenen Eltern zu kennen. Es liegt in der Natur dieser eigenartigen Beziehung, dass man von Eltern gedemütigt, geliebt, verlassen, gekränkt, geärgert oder schier um den Verstand gebracht wurde. Sobald man aber erinnernd nach ihnen greift, fliehen sie. Kurzum: es ist auch immer falsch, was wir von ihnen denken. Um dieses Falsche, aber auch darum, es als falsch kenntlich zu machen, habe ich mich bemüht.
Gab es einen Anlass, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen?
Keinen innerlich drängenden, aber einen von außen. Von den Herren Janetzki und Geiger vom Literarischen Colloquium wurde ich auf das Engagement der Robert Bosch Stiftung für Osteuropa aufmerksam gemacht. Dem konnte ich nicht widerstehen. Robert Bosch war der schwäbische Säulenheilige unserer Familie. Er stand in hohen Ehren, es wurden laufend Geschichten von ihm erzählt. Mein Vater bekam seine erste Anstellung als Arzt im Robert Bosch Krankenhaus. Im Alter von fünfzehn Jahren stand ich um sechs Uhr in der Früh vor den Toren der geheiligten Firma und wollte das Kampfblättchen des Spartacusbundes loswerden. Ein enttäuschendes Erlebnis. Die überaus vernünftigen Arbeiter zeigten mir den Vogel oder vielmehr, sie bohrten mir den Dippel, wie es bei uns zuhause heißt. Kurzum: wenn Bosch ruft, muss ein Schwabe folgen.
Ihre Bücher zeichnen sich durch wunderschöne Umschläge aus, die Sie selbst gestalten was bedeutet für Sie diese illustrierende, über den reinen Text hinausgehende Arbeit? Welche Bedeutung hat für Sie überhaupt das (materielle) Buch als Kunstwerk und bekommen Sie da nicht einen Schreck, wenn Sie ans E-Book denken?
Papierarbeiten machen mir Vergnügen. Ich schneide und knicke und falze und kritzele gern. Lesen wird für mich immer an die habhafte Materie Buch, Papier, und an das Seitenumblättern gebunden sein. Elektronische Bücher sind vor allem Gedächtniszerstörer. Das Gedächtnis funktioniert besser über körperlichen Kontakt mit der Materie, im Falle des Buchs geht es über die Finger. Was vor unseren Augen als Schrift aufzuckt und verschwindet, ist sofort wieder weg. Ich werde den herkömmlichen Büchern aber auch deshalb treu bleiben, weil ich schön gestaltete Bücher liebe. Oh, all die schlauen Handschmeichler in meiner Bibliothek! Sie sind übrigens oft zu billig. Es tut mir regelrecht weh, wenn sie so wenig kosten. Ich würde gern mehr dafür bezahlen. Für Bücher, heißt meine Devise, gib das Geld mit Freuden aus.
Ihr neues Buch erscheint nicht mehr bei der DVA, sondern im Suhrkamp Verlag. Was hat Sie bewogen, den Verlag zu wechseln?
Nicht so sehr ich habe gewechselt, sondern der Verlag DVA ist ein anderer geworden. Er gehört jetzt Bertelsmann, und die meisten Leute, mit denen ich bekannt war und die ich mochte, sind verschwunden. Es gab also keine Treuepflicht mehr. Und dann hat mich der Verlag verlockt, von dem ich immer schon die meisten Bücher gekauft habe. Wunderbares Geistrauschen all der erzklugen poetischen und philosophischen Stimmen im Hause Suhrkamp. Es war mir eine Ehre, da hinkommen zu dürfen. Die Verlegerin wirkt auf mich großherzig und inspirierend. Sie weiß, was sie will und besitzt einen ausgeprägten Charakter. Den »Verlag der Weltreligionen« halte ich für den interessantesten Neuankömmling auf dem Markt seit langem. Im Verlagsgewerbe haben inzwischen so etwas fade, alerte, verwaschene Figuren das Sagen. Wenn ich mit solchen Leuten zusammenkomme, fühle ich mich wie ausgelaugt. Bei Suhrkamp ist das gottlob anders. Und mein Instinkt gab mir recht: der »Apostoloff« wurde hervorragend betreut. Mehr Glück kann man nicht haben.