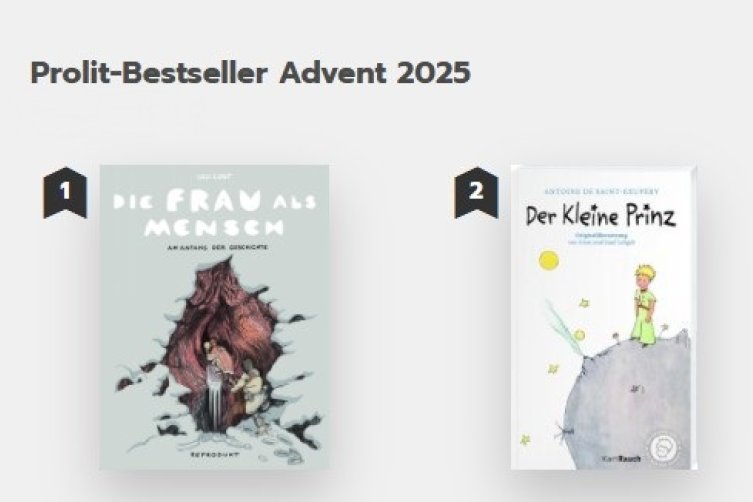Im Berliner Büro des Börsenvereins drängen sich die Journalisten. Hastig hat der Hanser-Verlag eine Pressekonferenz organisiert, die Leiterin der Presseabteilung Christina Knecht ist aus München eingeflogen und versucht, in dem Gedränge den Überblick zu behalten. Deutsche Medienvertreter sind ebenso gekommen wie rumänische und schwedische, einige waren schon auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse und machten im letzten Moment kehrt, als die Nachricht eintraf: Herta Müller bekommt den Literaturnobelpreis 2009.
Die Preisträgerin selbst geht in der Masse beinahe unter. Sie betritt den Raum durch eine Seitentür, schreckt angesichts der Menschenmenge etwas zurück, lächelt. „Das ist ein bisschen irr, das alles“, sagt sie leise, bevor sie notgedrungen für die Fotografen posiert, kurz nur, und, darum hat sie gebeten, möglichst ohne Blitz – ein Wunsch, der unerfüllt bleibt. Trotzdem lächelt Herta Müller tapfer, nimmt von Kulturstaatsminister Bernd Neumann einen Blumenstrauß entgegen und muss nun endlich etwas sagen. Wie fühlt man sich so als Literaturnobelpreisträgerin?
Sie sucht ein wenig nach Worten und nimmt schließlich Zuflucht zu jenem Satz, den man von ihr gleich nach Bekanntgabe der Entscheidung des Nobelpreiskomitees zu hören bekam: „Ich glaube es noch immer nicht. Das ist noch nicht im Kopf angekommen.“ Dann fügt sie hinzu: „Ich kann auch noch gar nicht darüber reden, ich brauche Zeit, um das einzuordnen.“
Aber diese Zeit will man ihr natürlich nicht lassen, auch wenn sie ihre Person am liebsten aus der ganzen Nobelpreis-Aufregung heraushalten würde: „Eigentlich bin das nicht ich. Es sind die Bücher und die sind nicht ich.“ Schon kommen die Fragen, die man einem Nobelpreisträger so stellt. „Wird der Nobelpreis Ihr Leben verändern?“ – „Wie ordnen Sie das für sich ein?“ – „Macht Ihnen das alles auch ein bisschen Angst?“ – „Wird der Preis Ihr Schreiben beeinflussen?“
Herta Müller reagiert in ihrer unnachahmlichen, feinen und etwas ironischen Art. Was solle das für ein Einfluss sein, sagt sie, sie sei doch jetzt nicht den ganzen Tag nur Nobelpreisträgerin und sie werde sicher kein Buch über den Nobelpreis schreiben. Wieso solle sie Angst haben, sie sei dieselbe Person wie zuvor, wenn sie schreibe, versuche sie nur, damit zu Rande zu kommen und das sei schon schwierig genug. Sie werde jetzt nicht besser und nicht schlechter schreiben als zuvor. Letztlich ist der Preis für Herta Müller eine Äußerlichkeit, erfreulich zwar, aber nichts, was den Kern ihrer Person berührt. Natürlich sei es schmeichelhaft, in einer Reihe mit Thomas Mann und Günter Grass genannt zu werden, meint sie, aber: „Ich kann doch jetzt nicht mit einer Galerie von Nobelpreisträgern im Kopf herumlaufen, so groß ist mein Kopf doch gar nicht.“
Zehn Jahre ist es her, seit mit Grass das letzte Mal ein Deutscher den Nobelpreis erhielt. Aber ist die in Rumänien geborene Herta Müller überhaupt eine deutsche Autorin? Eigentlich schon, sagt sie: „Insofern, dass ich immer auf Deutsch geschrieben habe. Ich habe Rumänisch erst mit 15 Jahren gelernt, ich mag diese Sprache sehr, aber um in ihr zu schreiben braucht man eine Intimität, die ich nicht habe.“ Ihre Texte hat sie auf Deutsch verfasst, auch wenn ihre Bücher sich mit Rumänien beschäftigen. „Literatur geht immer dorthin, wo Beschädigungen einer Person sind“, sagt Müller. Ihre eigenen Beschädigungen stammen aus Rumänien und dorthin kehrt sie literarisch immer wieder zurück. „Was geschehen ist, ist ja nicht ausgelöscht, das sitzt in meinem Kopf und ich habe nur diesen einen.“
So ist es kein Zufall, dass Herta Müller den Nobelpreis gerade 2009 erhält, 20 Jahre nach dem Mauerfall und dem Ende des Eisernen Vorhangs. Sie hat die ganze Härte eines totalitären Systems erlebt, wurde jahrelang vom rumänischen Geheimdienst verfolgt, verhört, bedroht: „Ich weiß, wie es ist, wenn man jeden Morgen Angst hat, dass man am Abend vielleicht nicht mehr existiert.“ Diese Ängste, diese Erfahrungen hat sie literarisch verarbeitet, nicht weil sie es wollte, sondern weil sie es musste: „Autoren suchen sich ihr Thema nicht aus, es stößt ihnen zu.“ Herta Müllers Thema ist die menschliche Zerstörung, die Darstellung dessen, was Menschen einander antun können, und nicht zuletzt die Frage, wie es so weit kommen konnte: „Daher rührt mein Schreiben. Ich habe mich gefragt, wie es sein konnte, dass sich einige wenige ein Land unter den Nagel reißen, dass dieses Land verschwindet und nur der Staat übrig bleibt.“
Dann hat Herta Müller die Fragen der Journalisten überstanden. Bernd Neumann richtet ihr Grüße der Bundeskanzlerin aus, schwärmt von der „Kraft der Worte“ in ihrer Literatur und lobt das Nobelpreiskomitee dafür, jemanden ausgezeichnet zu haben, „der etwas gegen das Vergessen tun will, das Vergessen von Wunden, die Menschen in einer Diktatur zugefügt wurden“. Deutschland sei stolz auf Herta Müller, sagt Neumann und Herta Müller lächelt zurückhaltend. Sie ist keine jubelnde Preisträgerin, keine, die nun wochenlange Feiern einläutet. Ihre Freude ist still, innerlich und fast ein wenig zweifelnd, als wolle sie fragen: „Kann das wirklich alles mir gelten?“
Aber da ist noch jemand, der sich freut: der Carl-Hanser-Verlag, bei dem Müller seit 2005 ihre literarische Heimat hat. Müllers vor kurzem erschienener Roman, „Atemschaukel“, hatte sich schon vor der Bekanntgabe des Nobelpreisträgers als Bestseller erwiesen. Fast 40.000 Exemplare seien bereits verkauft, sagt Christina Knecht. Nun hat man 100.000 weitere Bücher geordert. Kein Wunder, dass bei Hanser eitel Sonnenschein herrscht. „Es ist einfach großartig“, strahlt Christina Knecht, „das ist wunderbar!“ Und dann lacht sie bei der Erinnerung an das morgendliche Telefonat mit Verleger Michael Krüger. „Ich habe nur gesagt ,es ist Herta!’ und immer wieder ,es ist Herta!’ Und dann sagte er ‚es ist Herta?’ und dann riefen wir beide ,es ist Herta!’…“