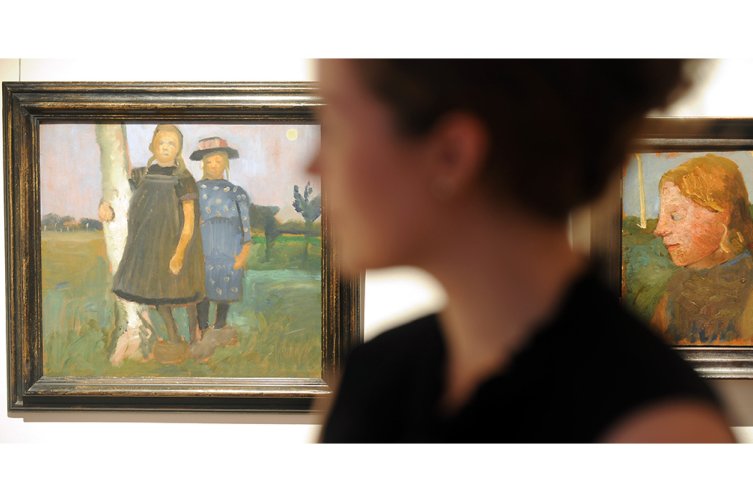Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann ist bei Journalisten für seine kantigen, so gar nicht weichgespülten Beiträge geschätzt. Jüngst, angesichts des Arbeitsantritts des siebten Kulturstaatsministers Wolfram Weimer – bald dreißig Jahre nachdem die erste rotgrüne Bundesregierung dieses Amt 1998 geschaffen hatte – machte er wieder einmal eine Ansage: „Die Bundeskulturpolitik befindet sich seit einiger Zeit im strukturellen Dornröschenschlaf. Was wir jetzt brauchen, ist ein Kulturstaatsminister, der den Bereich wach küsst, also seine Relevanz innerhalb der Bundesregierung stärkt. Schauen wir mal, was uns diese Legislaturperiode so bringt.“
Für Shila Behjat, Moderatorin eines Panels zur kulturellen Autonomie („Wie unabhängig sind unsere Kulturinstitutionen“) war der Satz eine Steilvorlage. Ob denn die Lobbyarbeit des Kulturrats, zu dessen 285 Kulturverbänden auch der Börsenverein gehört, also eher nicht so erfolgreich gewesen sei, wollte sie vom Kulturmanager wissen. Die alten Kämpfe zwischen Bund und Ländern, ob es eine sichtbare Kulturpolitik des Bundes überhaupt geben darf, meinte Zimmermann, gehören glücklicherweise längst der Vergangenheit an. Trotz der fast drei Jahrzehnte sei das Amt aber immer noch nicht wirklich gesichert. „Der Staatsminister darf als Staatssekretär zwar am Kabinettstisch sitzen, spricht aber nicht auf Augenhöhe“, so Zimmermann. Die kulturpolitisch spannende, im Vergleich zu anderen Panels aber eher schwach besuchte Runde am frühen Freitagnachmittag fragte nach Abhängigkeiten im Kulturbereich, finanziellen und politischen.