In einer ersten der zwei von Katrin Schumacher (MDR) moderierten Talk-Runden vor der Party setzten sich Karin Schmidt-Friderichs und Christoph Links in die Zeitmaschine. Die zweite weibliche Börsenvereins-Vorsteherin in 200 Jahren und der Ex-Verleger und Verlags-Historiker musterten den Branchenverband und seine politische Haltung über die Jahrhunderte im Schnelldurchgang.
Zwar sei der Ur-Impuls zur Gründung ein „praktisch-kommerzieller“ gewesen, so Links, rasch seien jedoch Fragen nach dem Schutz von Urheberrechten und vor Zensur hinzugekommen. Die „Anbiederung schrecklicher Art“ des Verbands an die NS-Machthaber erklärt der Historiker unter anderem mit der ökonomischen Schieflage, in dem sich Branche und Verein in den 1920er Jahren befanden.
Für das Angebot der Diktatur, die Pflichtmitgliedschaft für alle Buchhandlungen im Börsenverein durchzusetzen, den Buchexport zu fördern oder Schutzfristen zu verlängern, glaubte man, demokratische Prinzipien über Bord werfen zu können. Eine fatale Fehlentscheidung.
Am Ende kehrte der von Deutschland entfesselte Krieg zurück, waren Leipzig und das Grafische Viertel zerstört, gab es ein geteiltes Deutschland und zwei Börsenvereine. Die nach der friedlichen Revolution allerdings „schneller als Schriftstellerverbände und PEN-Zentren“ wieder zusammenfanden.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Geschichte für heute? „Der Börsenverein hat verstanden“, sagt Karin Schmidt-Friderichs. Erstes, deutliches Signal war die Einrichtung des Friedenspreises Anfang der 1950er Jahre; heute wird etwa die Woche der Meinungsfreiheit jährlich von der 2023 gegründeten Stiftung Freedom of Expression ausgerichtet. „Wir sind Kultur“, sagt Schmidt-Friderichs. „Und Kultur ist immer auch Politik.“
Christoph Links machte darauf aufmerksam, dass der Verband aus sich selbst heraus immer wieder kulturelle Aufgaben übernommen hat – so etwa die Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig. „Es gab eben vorher kein Reichspflichtexemplarabgabegesetz“, so der Verlagshistoriker, mit Freude am Zungenbrecher.

















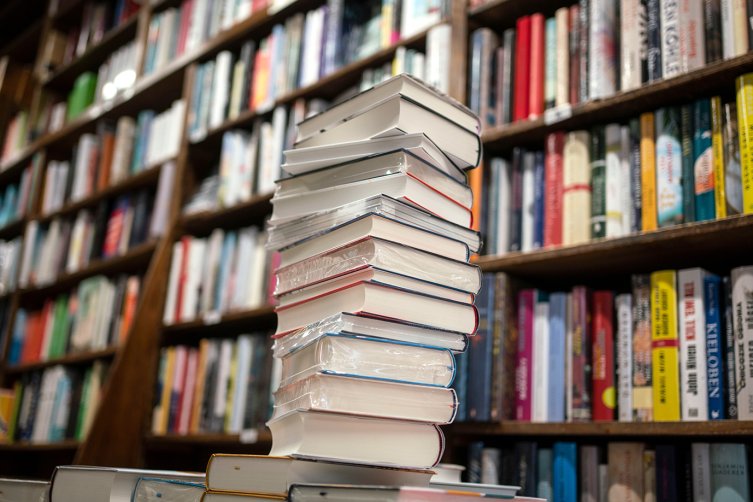


Wenn ich lese, dass Frau Annika Bach sich Gedanken "in Richtung „kommunaler Buchhandlungen“ in abgehängten Regionen" macht und die Politökonomin Göpel sogar von "regelrechten „Kulturversorgungs-Zentren“" träumt, dann bin ich geradezu sprachlos, zeigt es mir doch, dass hier offensichtlich kein akuter Handlungsdruck empfunden wird - Gedanken und Träume werden das grassierende Buchhandelssterben nicht aufhalten. Offensichtlich ist vielmehr die "strukturelle Verlagsförderung" nun das "heiße Eisen", was es gilt zu schmieden...
Nur was machen den all die (dann hoffentlich) geförderten Verlage in ein paar Jahren, wenn ein Großteil der kleineren und mittleren Buchhandlungen nicht mehr existieren und die dann vorhandene Vertriebsinfrastruktur nicht mehr diesselbe wie heute (bzw. vor Corona) ist?
Der Katapult-Verlag hat die wirtschaftliche Brisanz der Buchhandlungen erkannt und bietet nun Buchhandlungen jeglicher Größe (also egal ob eine kleine Buchhandlung oder ein großer Filialist) die gleichen Konditionen: 50% - schon interessant dass dies dem Börsenblatt keine Meldung wert ist...
"Nach jeder letzten Seite folgt: Ein neues Kapitel" - manchmal ist aber auch einfach die Geschichte nach der letzten Seite zu Ende.
Sehr geehrter Herr Kunze,
in Ihrer Einschätzung stimme ich mit Ihnen überein. Die wirklich wichtigen Branchendiskussionen werden vom Börsenverein seit Jahren schon erfolgreich umschifft und stattdessen nebelkerzenartig neue Arbeitsfelder aufgemacht, um Aktivität vorzutäuschen, wo schlussendlich nur Passivität ist. Als Ergebnis bleibt für kleinere Buchhandlungen und kleinere Verlage die nüchterne Erkenntnis, dass sich für uns eine Mitgliedschaft eigentlich fast nur noch wegen der Verkehrsnummer und einiger branchenspezifischer juristischer Handreichungen lohnt, die doch einiges an Arbeit erleichtert.
Und es bleibt die Erkenntnis, dass dieses System, so wie gehabt, ausgeübt und gepflegt, über kurz oder lang eh kollabieren wird, schlussendlich auf zwei große Player hinausläuft und sich dann für den Rest ohne den Börsenverein eben etwas Neues finden muss. Denn dieser entzieht sich ja aktuell aufgrund der Untätigkeit erfolgreich nicht nur seiner eigentlichen Verantwortung für einen funktionierenden Sortimentsbuchhandel, er wird irgendwann vor der Frage stehen, wer ihn denn überhaupt noch braucht.
Im Zuge der New Economy, deren Feld der Börsenverein ja mit dem ganzen Digitalisierungsgetröte ausführlichst mitbespielt, heißt die Zukunft dann eben Disruption. Wir zerstören also etwas noch Funktionierendes und ersetzen es durch etwas, was mit Dysfunktionen behaftet ist, die in Frankfurt nicht mehr gesehen werden wollen oder mangels Geistesvermögen oder Intellektualität gar nicht mehr gesehen werden können.
Ich fürchte, dass Buchhandlungen wie Sie oder wir zu absoluten Einzelkämpfern werden und empfehle als aktuelle Begleitlektüre Gabriel Yorans „Verkrempelung der Welt“ (978-3-518-03002-8). Mit einem entsprechen Galgenhumor lässt sich dieses Buch mit großem Vergnügen lesen, denn Yoran beschreibt exakt die Entwicklung, vor der Sie, wir und viele Verlage nicht nur stehen – wir sind in dieser Entwicklung bereits mittendrin!
Herzlichst grüßt aus Köln
Jens Bartsch – Buchhandlung Goltsteinstraße